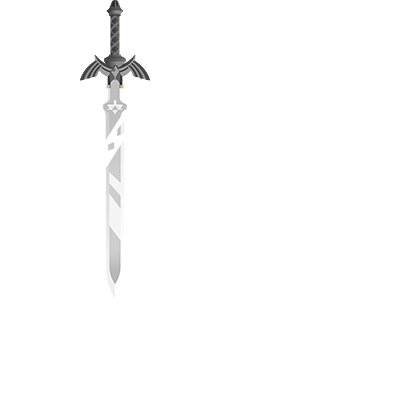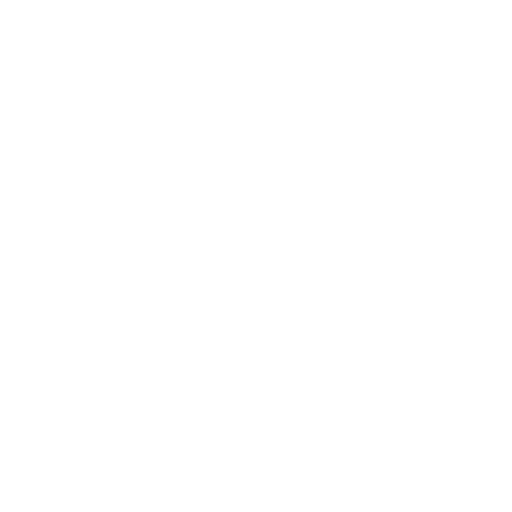Ich weiß, jetzt ist wahrscheinlich nicht die richtige Zeit um diesen doch recht philosophisch angehauchten Text zu verfassen. Ich tu es aber dennoch, da ich glaube morgen nicht mehr alles zusammen zu bekommen, was ich sagen möchte.
Ich werde zunächst erst einmal meinen Standpunkt zu dieser Sache darlegen und danach auf eure Stimmen eingehen.
Beginnen möchte ich meine Ausführungen mit einem Zitat von Michelle de Montaigne, einem französischen Moralisten des sechzehnten Jahrhunderts:
Zitat
Es ist noch nicht ausgemacht, an wem der Fehler lieget, dass wir einander nicht verstehen, denn wir verstehen die Tiere ebenso wenig, als sie uns verstehen. Sie können uns aus eben dem Grunde unvernüfnftig halten, aus welchem wir sie dafür halten.
Und selbst wenn diese Aussage um die vierhundert Jahre alt sein dürfte, so kommt sie doch auch sehr nahe an das Wal-Beispiel von Nusma heran. Ich denke in diesem Fall, dass wir eben keine Möglichkeit haben, die Kommunikation mit Tieren dererlei zu gestalten, als dass wir uns auf einer intellektuellen Ebene verstehen könnten. Natürlich gibt es eine Verständigung zwischen Mensch und Tier, die bei der einfachen Interaktion mit Vöglen, die fortfliegen sobald man sich nähert, beginnt und bis hin zum Hund oder zum Pferd wirkt, welche beide in der Lage sind menschliche Laute als Befehl wahrzunehmen. Sicherlich liegt diesem Lernmodell des Tieres, auf den Laut eine Reaktion folgen zu lassen in einem Konditionierungseffekt, aber dennoch gibt es auch weiterhin unterschwelligere Botschaften, die der Mensch dem Tier und das Tier dem Menschen vermittelt. Ist der Mensch ängstlich verhält der Hund sich anders. Ist der Mensch nervös, ist auch das Pferd leichter aus der Ruhe zu bringen. Anscheinend gibt es eine Art von Ver-ständigung zwischen Mensch und Tier, die keine verbale - und somit auch keine differenzier-/deffinierbare - Kommunikation benötigt.
Und ich glaube hier beginnt ein Teil von dem, was den Menschen von den anderen Tieren unterscheidet. Es gibt im Johannesevangelium den Satz:
Zitat
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. (Johannes,1.1.)
Ich bin keineswegs ein bibelfester Mensch, noch sehr religiös, obgeich mir durch meine katholische Taufe die meisten Sitten und Bräuchen des Christentums nicht unbekannt sind. Was ich aber mit diesem Zitat zum Ausdruck bringen möchte ist, dass in der altgriechischen Form noch anstelle des 'Wort', der Begriff '»Ì³¿Â' bzw. 'lógos' steht. Die Übersetzung als Wort ist nur die eine Variante, wobei mit Logos auch der Gehalt des Wortes, also dessen Sinn bezeichnet wird, sowie auch das geistige Vermögen und was dieses hervorbringt. Letztlich wird dieses Wort auch ähnlich wie das 'Tao' der fernöstlichen Philosophie als ein Prinzip der Weltvernunft oder der Gesamtsinn der Wirklichkeit verstanden. Wir finden es immer noch in unserer Sprache als Logig oder der Logopädie und den Wissenschaften (Biologie, Psychologie, Anthropologie, Virologie etc.).
Da ich der Meinung bin, dass die Religion aus dem Spiegelbild der inneren Realität des Menschen entstanden ist, denke ich, dass gerade dieser Gedanke, der das Glauben eines reinen Geistes, eines letzten Urgrundes, einen bedeutenden Schritt zur Unterscheidung zwischen Mensch und Tier gemacht hat. Natürlich ist das auch nur eine Spekulation, da wir eben nicht wissen, ob, wenn Elefanten, Wale oder Elefantenrüsselfische sich akkustische oder elektrische Signale zukommen lassen, nicht doch Inhalte von der Tragweite wesentlicher Erkenntnisse überliefert werden.
Wie Midna schon anführte gibt es die evolutionsbiologische Sicht, nach der der Mensch durch seine Fähigkeit sich seines Verstandes zu bedienen einen Vorteil im 'struggle for life' hatte. Er erschuf sich eine Art zweite Natur, so wie wir heute Kleidung als eine zweite Haut tragen: Die Kultur.
Nun möchte ich darauf hinweisen, dass diese zweite Natur nicht etwa unabhängig, oder gar etwas gänzlich anderes als die Natur ist, in welcher der Mensch den Gewalten ausgeliefert ist, sondern, dass die Kultur ebenso den Gesetzmäßigkeiten der Naturgesetze unterworfen ist. Was nun hinsichtlich auf den Menschen interessant ist, ist, dass dieser sich neben den Naturkräften, gegen die er sich zu behaupten hat, nun selbst Gesetze erlässt. Er setzt sie neben die unveränderlichen Naturgesetze. Hier gibt es dann auch durchaus Parallelen zum 10-Gebote Thread, zu dem mein Post auch noch folgen wird.
So gesehen ist diese Kultur-Natur vielleicht komplexer als der Termitenbau, in dem ja auch schon eine gewisse Arbeitsteilung besteht. Dennoch denke ich (und da bin ich knallharter Determinist), dass auch diese Vorgänge durch grundlegende physikalische, chemische und biologische Naturgesätze bestimmt sind, die letzendlich zu psychologischen, philosophischen und soziologischen Gesätzmäßigkeiten führen. Letztere sind zwar weitaus komplexer und spezifischer, aber dennoch bedingt durch die kausale Wechselwirkung kleinster Teilchen.
Und ob der Mensch mit seinem Gehirn, das ich für das komplexeste Gebilde innerhalb des Universums (das Universum selbst mal ausgenommen) halte, das was um ihn her in der 'äußeren' Realität geschiet in die 'innere' Realität zu übernehmen, wirklich besser oder schlechter ist als andere Wirbeltiere, Tiere, Lebewesen, Materie ist, das kann über diesen Ansatz nicht geklärt werden.
Wenn man diesen Gedanken weiter spinnt kommt man nämlich rasch in eine argumentative Bredouille. Wenn doch alles von den Gesetzen determiniert ist, wo bleibt dann die individuelle Freiheit. Die Möglichkeit sich gut und richtig zu entscheiden. Letzlich, wo bleibt die Moral und die Ethik. Und hier bin ich nun in einem Widerspruch zu Mereko:
Zitat
Wir lieben uns, wir hassen uns, wir bilden Gesellschaften, weil wir es wollen und nicht, weil unsere Instinkte es uns vorgeben (Schwarmkollektiv/Rudel/Herde).
Also scheint auf dem ersten Blick entweder die Kausalität in Frage gestellt, da sie bei uns aufhören soll und uns eine Freiheit ermöglicht, oder genau dies Freiheit ist nicht möglich, da alles determiniert ist.
Wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder heraus? Es geht ja immer noch darum, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und wir sehen unsere Freiheit und unsere Intelligenz als wesentliches Kriterium, das uns von den animalischen Tieren trennt.
Um dieses Dilemma zu lösen hat Immanuel Kant seinerzeit eine Unterscheidung in zwei Welten gefordert. Die 'phänomenale Welt', in der der Determinismus die Welt so bestimmt, dass die Gesetze der Natur ohne Ausnahme walten, steht der 'noumenalen Welt' gegenüber, die als eine Welt der Vernunftgründe und der Dinge 'an sich' angesehen werden kann, die keinerlei Anschauung in der phänomenalen enthält, da sie rein objektiv sein soll.
Genau aus dieser 'noumenalen' Welt etstammen nun die Begriffe und moralischen Werturteile, wie richtig und falsch. Wir besitzen also nicht nur ein Vokabular, dass das richtige und flasche Handeln beschreibt, sondern auch ein den Glauben, dass wir die Wahl haben. Und gerade dieser Glaube, die Wahl zu haben, veranlasst den Menschen seine Entscheidungen einer Wertung und Kritik zu unterziehen, die er mit der Vernunft mithilfe seines Verstandes unternimmt.
Ich denke genau hierin liegt der wesentliche Unterschied. Der Mensch besitzt Empfindungen wie Schuld, Reue, Mitleid, Empörung und Pflichtgefühl.
Und hier muss ich Mereko beipflichten. Der Mensch hat neben den, durch Hormone und Stoffwechsel bedingten Gefühlen die Emotionen, die auch kognitive, psychische und soziale Aspekte beinhalten. Emotionen ergeben sich aus dem Wert und der Beimessung, die wir den Dingen geben (zwar in großer Übereinstimmung mit den Gefühlen, aber durchaus mit einem stärkeren Intensität.
Nun wäre an dieser Stelle allerdings zu fragen, ob wir Menschen als alleinige Besitzer von Emotionen gelten dürfen. Sind nicht vielleicht auch Tiere in der Lage entsprechende Emotionen auszubilden, sie aber nicht durch Sprache verlautbar zu machen? Es gibt Fälle in denen uns verwandte Wirbeltiere ähnlich komplexe Verhaltensmuster und Kommunikationsstrukturen zeigen, wie junge Kinder. Ist der Affe, der auf seiner Tafel verschiedene Felder antippt, um dem Pfleger mitzuteilen, was er fressen möchte weniger frei als der Mensch? Sind Delfine, Elefanten, Hunde, Pferde ebenso nur durch Instinkte bestimmt? Hier wären wir wieder am Anfang.
Vielleicht läuft es letztendlich darauf hinaus, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier darin besteht, dass der Mensch denkt, dass es einen gibt.
![]() [/SIZE]
[/SIZE]